Deniz Ohdes Erstling „Streulicht“ war das sprachlich starke Buch einer jungen Autorin, die sehr genaue Bilder für ihre Umwelt fand. Es erzählte die Geschichte einer Befreiung aus engen Verhältnissen durch Bildung. Das kennt man vor allem von französischen Autor:innen wie Didier Eribon, Annie Ernaux oder Édouard Louis. In diesem Fall wuchs die Ich-Erzählerin inmitten des Industrieschnees der ehemaligen Hoechst AG auf. Den kenne ich ebenfalls aus der Kindheit, was mir beim Lesen zusätzliche Gänsehaut bescherte.
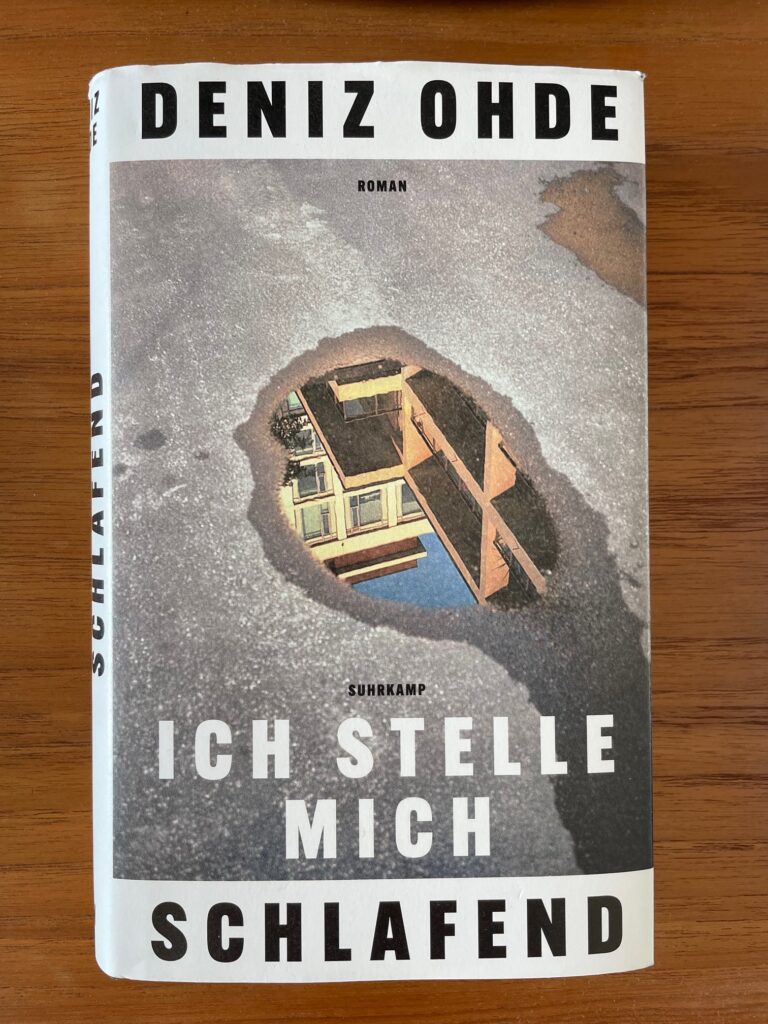
Nun sind die Rezensenten in den deutschen Feuilletons durchaus uneins, wie „Ich stelle mich schlafend“ zu bewerten ist. Einige sehen Kitsch und Schwarzweißmalerei am Werk (wie Lara Sielmann im Deutschlandfunk) oder einen etwas starren und klischeehaften Plot (wie Nina Apin in der Taz). Einig sind sich alle immerhin darin, dass das Thema – die Gewaltförmigkeit von Beziehungen zwischen Männern und Frauen und ihre weitgehende Akzeptanz – ein wichtiges ist.
Die Geschichte von Yasemin, deren Leben zu Beginn der Erzählung buchstäblich in Trümmern liegt, weil sie sich aus einer toxischen Beziehung erst spät befreien kann, erzählt Ohde in Rückblenden und auf Umwegen. Sie greift zurück auf Erzähltraditionen wie das Lukas-Evanglium und beobachtet den Alltag Heranwachsender in den Häusern einer Stadtrandsiedlung. Sie registriert familiäre Forderungen an sie und deren Internalisierung; aber ebenso Strategien der Mädchen, spielerisch einen Umgang mit der Welt zu finden – und Nischen, in die sie sich zurückziehen können.
Doch es hilft nichts. Wie im dem Buch vorangestellten Bibelzitat – „Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit achtzehn Jahren einen Geist, der sie krank machte; und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten“ – zieht sich das Motiv der Beugung durch Yasemines Geschichte. Sie schreibt sich tief in ihren Körper ein und wird nur allzu bereitwillig angenommen.
In Wiederholungsschleifen berichtet Ohde davon, wie Yasemin aus Freundlichkeit darauf verzichtet, nein zu sagen, noch bevor sie überhaupt weiß, wozu sie eigentlich ja sagen könnte. Um unauffällig zu bleiben, antizipiert sie die Wünsche anderer, beugt sich ihnen und verwechselt das manchmal mit Liebe.
Schicht um Schicht schlägt sich der Text in Windungen durchs Dickicht ihrer Gefühle und Prägungen. Jedem Schritt in Richtung Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung folgt mindestens einer, der sie wieder zurückwirft. Die Idee, nicht zu genügen, sich schuldig gemacht zu haben, ist ständig präsent. Sie führt zum Wunsch nach Reinigung und Buße, der Yasemin nach vielen Enttäuschungen vom endlich eingeschlagenen Weg in Richtung Stabilität wieder abbringt. Er treibt sie zurück in die Arme des ersten Freundes, der schon als Teenager vor allem als zornig beschrieben worden ist …
Erst kurz vor dem Ende steht die Erkenntnis, dass es nicht so hätte kommen müssen, aber so gekommen ist. Ohne Zutun eines Schicksals, das sich in Zeichen und den Karten des Tarots zu erkennen gibt. Das ist nicht wenig. Es ist noch keine Ermächtigung, aber ein vielleicht ein Anfang.
Deniz Ohdes zweites Buch schmerzt bisweilen beim Lesen. Das ist vielleicht vor allem ein Zeichen dafür, dass es in der Lage ist, etwas zu bewirken. Dabei gelingt es der Autorin, die persönliche Anteilnahme der Leser:innen zu nutzen, um vom größeren Gesamtbild Zeugnis abzulegen: Denn hier geht es nicht um schwache Frauen, die zu Opfern werden, sondern eine gefährliche Ungleichheit, die systemisch ist und seit Jahrhunderten beständig weiter fortgeschrieben und eingeübt wird.